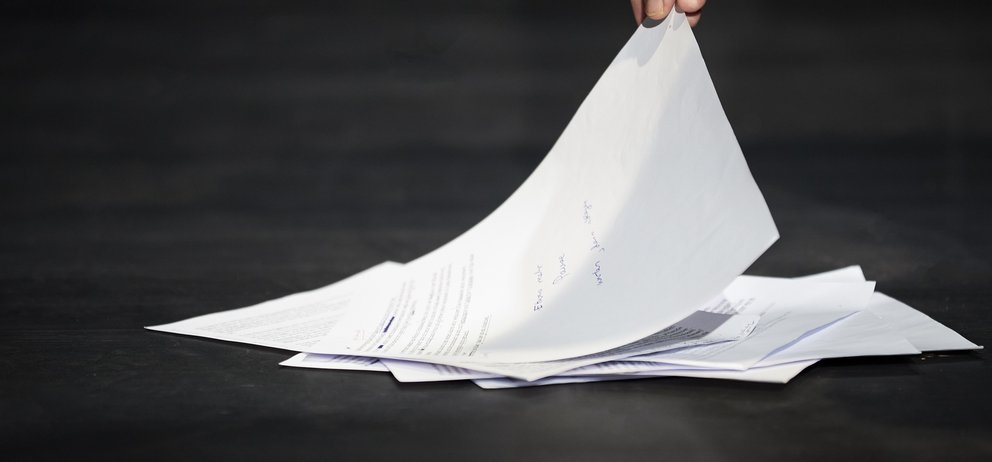Boris Nikitin spricht im Interview über seine neue Arbeit “Magda Toffler“, die im März am HAU zu sehen ist.
In “Magda Toffler“ geht es um ein besonderes Ereignis: Im Sommer 2009 bekommst Du einen Brief zu lesen, der offenbart, dass deine Großmutter aus einer jüdischen Familie stammte. Später erfährst du, dass ein großer Teil dieser Familie in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern ermordet wurde. In dem Brief steht auch, dass deine Mutter, deine Geschwister und du Juden seien. Kannst Du dich noch an deine erste Reaktion erinnern?
Ich musste erst einmal lachen. Ich bin ja Kind von Einwanderern und erlebte mich selbst immer schon in einem wurzellosen Identitätsmischmasch. Meine Mutter ist Slowakin, früher war sie Tschechoslowakin, mein Vater war halber Franzose und halber Ukrainer mit russischen Wurzeln. Es gab viel Migration in dieser Familie, alles geprägt durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts: die russische Revolution, der Zweite Weltkrieg, der Kalte Krieg. Auf die Frage nach meiner Identität konnte ich noch nie mit einem vernünftigen klaren Satz antworten. Zu diesem Wirrwarr kam in meinen Teenagerjahren das Schwulsein hinzu mit allem Ringen mit der Realität und ihren Normen, dem Suchen nach einem Vokabular. Und dann kommt so ein Brief und setzt noch einen oben drauf.
Das Lachen als eine Reaktion der Überforderung? Weil sich zu den verschiedenen Fragmenten deiner Identität nun ein weiteres gesellte?
Ein absurdes Lachen, ja. Zugleich war da ein Gefühl der Erleichterung, verbunden mit dem Versprechen eines möglichen Neubeginns. Die Möglichkeit, dass man jemand anderes sein könnte. Es hatte etwas von dem großen Familiengeheimnis, das gelüftet wird und mit dem man möglicherweise all die Fragen und Gedanken, all das lange Hadern plötzlich erklären könnte. Immerhin brach der Brief mit einem jahrzehntelangen Schweigen, von dem ich überhaupt nichts wusste. Schweigen ist ja etwas, das es eigentlich gar nicht gibt. Sowas interessiert mich.
Ist das der Ausgangspunkt des Stückes?
Das ist der Ausgangspunkt. Gleichzeitig geht es um die Geschichte meiner Großmutter. Sie war eine schwierige, faszinierende Persönlichkeit. Und es geht um ihre Cousine in Tel Aviv, die uns den Brief schrieb und von der ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie etwas gehört hatte. Ich besuchte sie ab 2010 regelmäßig. Ebenfalls eine erstaunliche, starke Person. Sie war ein wandelndes, gnadenloses Gedächtnis. Im Gegensatz zu meiner Großmutter hatte sie es sich zur Aufgabe gemacht, von allem, was sie erlebte, bis ins kleinste Detail genau zu berichten. Sie starb 2018 im biblischen Alter von 102 Jahren – sie hatte die Shoa überlebt, in Israel neun weitere Kriege durchgemacht, eine ihrer Töchter nahm sich das Leben, sie pflegte ihren Ehemann zehn Jahre lang zuhause und am Schluss gab’s einen Krebs obendrauf, weil man ja an irgendetwas sterben muss. Ein bedingungsloses Leben.
“Magda Toffler“ ist auch eine Fortsetzung von “Versuch über das Sterben“. Thematisch scheinen Verbindungen auf: im ersten Stück ging es um das Coming-Out, also die Selbstermächtigung zum Sprechen, nun geht es um dessen Gegenstück, das Schweigen.
Das ist auf jeden Fall so. Mich interessiert, was die Gründe waren, dass meine Großmutter nie über ihre Familie gesprochen und sie damit zur Unsichtbarkeit verurteilt hatte – und damit auch einen Teil von sich selbst. Nicht einmal meine Mutter wusste irgendetwas. So ein Schweigen macht etwas mit einem Menschen und seinem Umfeld. Es legt sich über alles. Die Familie weiß natürlich nichts davon und der schweigende Mensch vergisst es mit der Zeit. Irgendwann wird das Ganze zu einer unhinterfragten selbstverständlich gewordenen Normalität.
Man könnte auch sagen: so funktioniert Realität.
Das ist so ein Gedanke, der mich fasziniert: Inwiefern ist die Realität durch all die unausgesprochenen Dinge gleichermaßen geformt, wie durch die Dinge, die wir ausgesprochen haben? Als ich in den Nullerjahren noch studiert habe, frequentierte ich eine Zeit lang wegen depressiver Schübe einen ziemlich verblüffenden, systemischen Psychotherapeuten. Er hatte seine Praxis in einer Villa, die auf einem bewaldeten Hügel in Marburg stand. Ein Ort wie aus einem Film. In einer Sitzung streckte er mir auf einmal seine flache Hand entgegen, um mich von meiner Traurigkeit abzulenken und fragte: was macht die Hand eigentlich aus, die Finger oder die Räume zwischen den Fingern?
Eine Analogie dieses Bildes kommt auch am Anfang von “Magda Toffler” vor, in der Beschreibung der Posener Konferenz und Himmlers Rede, in der dieser den versammelten Gauleitern die Endlösung verkündet. Niemand erwidert etwas.
Das Schweigen ist der leere Raum zwischen den Körpern und den Wänden. Man könnte ihn mit Beton ausgießen und hätte eine Skulptur wie bei Rachel Whitehead.
Du hattest diese Episode schon in eine früheren Produktion drin, nun bildet es die Klammer des neuen Stücks. Was beschäftigt dich an dieser Geschichte?
Ich möchte wissen, welche konkreten Mechanismen dazu führten, dass jedes einzelne Individuum in diesem Saal nichts sagte - was wiederum jene gemeinsame Stille fabrizierte, die den Wahn-sinn überhaupt erst ermöglichte. Das wiederum ist das Echo einer Frage, mit der ich mich seit meinem eigenen Coming-out vor über zwanzig Jahren regelmäßig beschäftige: wie entsteht Schweigen überhaupt? Dieses Sich-Verstecken, dieses Abwarten. Was ist seine Mechanik? Wie entstehen solche Realitäten? Man könnte auch sagen: wie entsteht Kollektivität?
Wie meinst du das?
Kollektivität entsteht ganz maßgeblich durch stille Verabredungen. Eine Norm ist ohne Schwei-gen nicht denkbar. Letztlich ist das ja genau das, worüber wir alle seit mehreren Jahren diskutie-ren. Daher ja auch das obsessive Ansprechen, das permanente Outen. Die Frage nach Sichtbar-keit/Unsichtbarkeit ist eine Frage hinsichtlich des Kollektivs. Wer gehört dazu, wer nicht?
An einer Stelle schreibst Du, dass Du nicht wissen kannst, weshalb deine Großmutter ihre Geschichte im Verborgenen hielt. Du könntest nur spekulieren und dass es wahrscheinlich sei, dass du in erster Linie über dich selbst sprichst.
Ich glaube, wir tun das ohnehin immer. Ich kann versuchen, mich in einen Menschen hineinzuversetzen und ich kann versuchen, Informationen historisch-kritisch abzugleichen, aber am Ende bleibt es immer ein subjektives Experiment. Dessen muss ich mir bewusst sein, wenn ich mit einem nicht-fiktionalen Stoff arbeite.
Du versuchst dich in die Situation deiner Großmutter hineinzuversetzen: Die Angst, entdeckt zu werden und die daraus resultierende Notwendigkeit, sich zu verstecken.
Das ist das, was ich als Künstler tun kann. Ich versuche, in das Schweigen hineinzubohren, das eine Angst vor dem Sprechen und dessen Konsequenzen ist. Das ist etwas, das ich selbst gut kenne. Dieses Zögern, dieses Stottern. Dass es einem aus Unsicherheit, oder Scham die Sprache verschlägt. Dass man das Aussprechen auf morgen verschiebt. Und dann auf übermorgen. Und dann auf überübermorgen. Und – bumm – sind dreißig Jahre vergangen, der Körper ist alt geworden, die Welt an einem vorbeigezogen und du sitzt auf einer Bank, blickst auf dein Leben und seufzt wie eine Figur bei Tschechow „ach!“.
In dem Stück steht an einer Stelle “Und dann begann das Warten. Auf Veränderung. Auf eine Zukunft. Für manche ein Leben lang.”
Zögern, schweigen, warten, verpassen – die andere Seite einer linearen Fortschrittsgeschichte.
Demgegenüber steht die Hoffnung, doch eine eigene Stimme zu finden.
Dieser Hoffnung nachzugehen ist etwas, das mich antreibt. Auch wenn “die eigene Stimme” in den letzten Jahren eine immer zwiespältigere, mitunter obszöne Thematik geworden ist. Dennoch besteht genau darin für mich ein Sinn des künstlerischen Arbeitens. Immer wieder die eigene Furcht zu überlisten, sie in eine Motivation umzuwandeln und daraus etwas Interessantes zu produzieren. Das hat etwas Alchemistisches. In der Kunst geht es immer um Transformation.
Du beschäftigst Dich seit vielen Jahren auf kritische Weise mit dem Dokumentarischen. Gerade das Inszenieren von ‘echten Menschen’ auf der Bühne hast du immer wieder skeptisch kommentiert. Nun gehst du zum zweiten Mal mit deiner eigenen Geschichte auf die Bühne. Ein Widerspruch?
Der Selbstwiderspruch ist die einzige ideologische Agenda, die ich als Künstler verteidigen will.
Gleichzeitig spielen Dokumente in der Geschichte deiner Großmutter eine wesentliche Rolle.
Das stimmt. Letztlich ist jedes Staatsverbrechen immer auch eine Geschichte der Dokumente, mit denen es vollzogen werden konnte. Mich interessiert ja seit je her die Verbindung zwischen dem Dokumentarischen und dem Dokument als juristisches und politisches Instrument, mit dem Realitäten und Identitäten konstruiert werden. Die Welt als Produkt administrativer Entscheidungen. Man kann Menschen mit Dokumenten auf etwas festlegen. Man kann Menschen Rechte geben und Rechte nehmen. Das passiert jeden Tag, überall. Es ist auch heute möglich, dass über Nacht ganzen Bevölkerungsgruppen mit einer Unterschrift die Lebensgrundlage entzogen wird. Du wachst am Morgen auf und bist plötzlich Ungeziefer. Sprache kann das.
Dieses Verhältnis von Dokument und Identität spiegelt sich auch in der Inszenierung wider, die auf radikale Reduktion setzt: Du sitzt auf der Bühne und liest einen Text. Mit dem Text hast du ein Dokument in der Hand, dass dich auf etwas festschreibt. Insofern ist das, was Dokumente tun, genau das, was ich auf der Bühne sehen kann. Da ist das Dokument und da ist der Mensch und ich sehe, was zwischen ihnen passiert.
Das finde ich eine interessante Beobachtung. Ich glaube, dieser Assoziationsraum öffnet sich durch die formale Reduktion.
Du hast diese reduzierte Form bereits in “Versuch über das Sterben” angewendet. Was hat dich dazu bewogen, sie erneut zu wählen?
Bei diesen Arbeiten interessiert mich die Geste der Unterlassung: angekündigt ist ein Theaterstück und nun kommt plötzlich der Regisseur auf die Bühne, setzt sich auf einen Stuhl und liest einen persönlichen Text vor. Das ist alles. Es hat etwas Befreiendes.
Ein Thema, das die ganze Zeit über dem Stück schwebt, ist das der Identität. Das beschäftigt unsere Gegenwart wie kaum ein anderes. Du hast vorhin gesagt, dass Du auf die Frage danach nie mit einem klaren Satz antworten konntest. Hat sich etwas daran geändert, seitdem Du erfahren hast, dass Du – nach jüdischem Gesetz – Jude bist?
Es hat sich vieles geändert. Auf einmal hatte ich hundert Verwandte mehr, mit denen mich eine Geschichte verbindet. Ich habe diese Menschen kennengelernt, mit einigen hat sich eine Freundschaft entwickelt und das ist ein Geschenk. Und ich denke natürlich oft darüber nach, wie es gewesen wäre, wenn ich mich von Kind an als Teil eines uralten Volkes hätte verstehen können. Aber für mich bleibt das ein Fragment unter vielen. Identität ist für mich ein Wort, das mich verunsichert, mich ins Stottern bringt. Es fällt mir nach wie vor schwer, auf die Frage danach zu antworten, aber ich bin nicht unglücklich damit. Nicht-Identität ist mir einfach näher.
Es wird in dem Stück ja auch sehr deutlich, dass eine Freiheit darin liegen kann, sich nicht festlegen zu müssen. Gerade, wenn man es schlicht nicht kann, weil es für das, was man ist, nicht mal einen Begriff gibt. Machst Du deswegen seit über 15 Jahren Theater über die Konstruktionen von Realität und Identität? Weil die Nicht-Identität dir näher ist?
Diese Frage hab ich mir oft gestellt. Als ich 27 war, begann ich, diese Thematik ins Zentrum meiner Arbeit zu stellen. In den frühen Inszenierungen ging es darum, dass das, was wir als Zuschauer*innen zu sehen oder wahrzunehmen glauben, unzuverlässig ist. Es ging dauernd um gefälschte Dokumente, gefakte Realitäten, kopierte Biografien, Propaganda. Das Stück “Imitation of Life”, auf das ich mich in “Magda Toffler” immer wieder beziehe, war eine ironische Kampfansage an das Dokumentarische. Nachdem der Brief aus Tel Aviv kam und sich ein Teil meiner Familiengeschichte nochmals ganz anders zeigte, fragte ich mich, ob diese Auseinandersetzung vielleicht nicht nur mit einem ästhetischen Interesse zu tun hatte, sondern einfach das unweigerliche Produkt meiner eigenen Geschichte war. Ein sehr verführerischer, beruhigender Gedanke. Trifft er zu? Ich weiß es nicht.